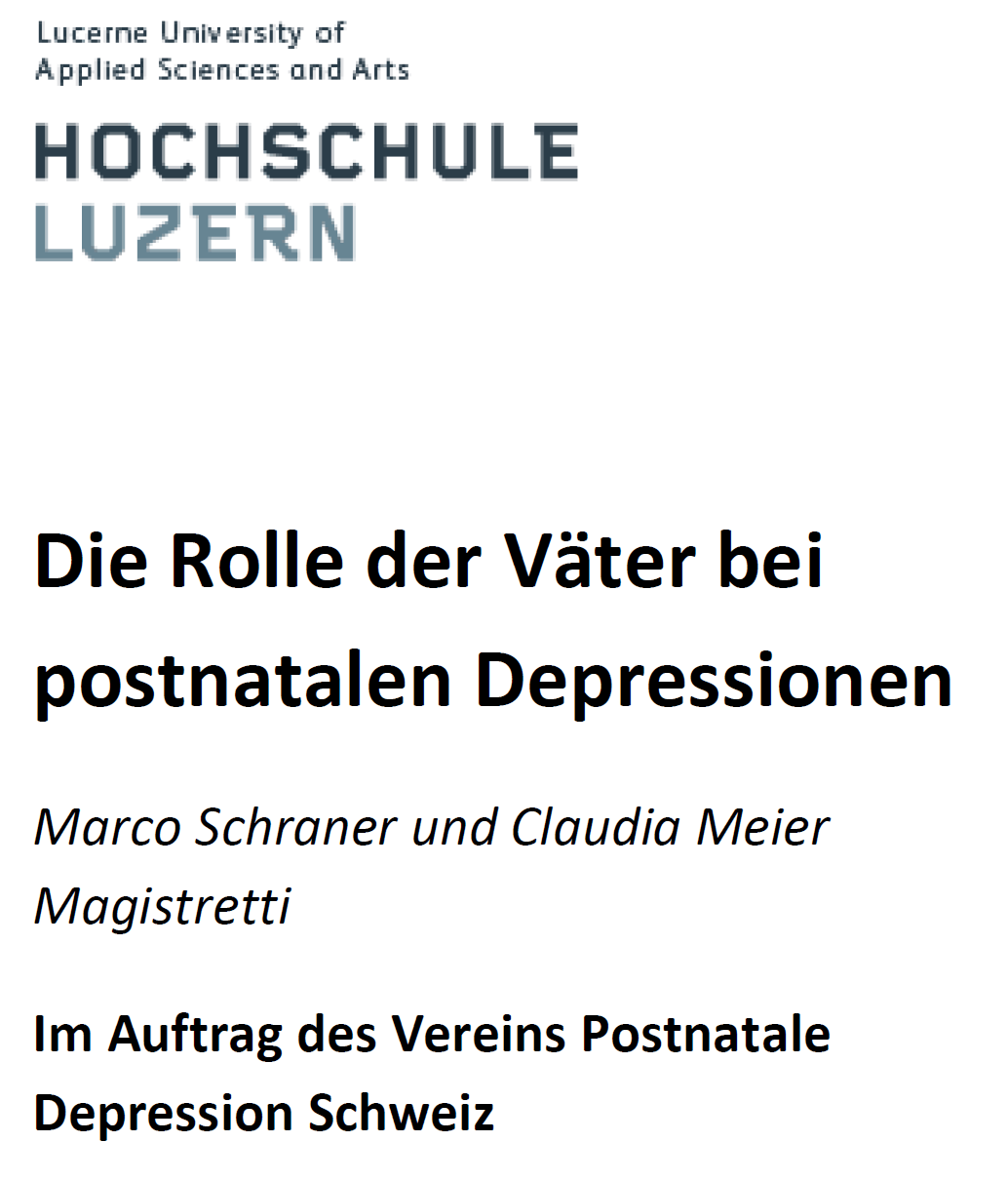Postnatale Depressionen bei Frauen sind glücklicherweise kein Tabu mehr, auch wenn sie vielfach immer noch als ‚Baby Blues‘ verharmlost werden. Im deutschsprachigen Raum ist aber wenig darüber bekannt, wie die Partner von postpartal depressiv erkrankten Müttern mit der mehrfachen Belastung umgehen, welche die Geburt eines Kindes und die gleichzeitige Erkrankung der Partnerin bedeutet. Abhilfe sollte eine von Marco Schraner und Claudia Meier Magistretti von der Hochschule Luzern durchgeführte Literaturstudie schaffen. Ziel der vom Verein Postnatale Depression Schweiz beauftragten Studie war es, mehr Wissen zu erarbeiten und in Erfahrung zu bringen, wie Väter diese Situation erleben, welche Bewältigungsstrategien sie entwickeln und welche Unterstützung ihnen helfen könnte, ihre Partnerinnen zu unterstützen und dabei selber gesund zu bleiben.
Die Aufmerksamkeit des medizinischen Personals ist bei der Geburt ebenso wie bei postnatalen Depressionen vor allem auf die Mütter gerichtet. Väter haben oft das Gefühl, nicht gehört zu werden und dass ihre Bedürfnisse übersehen werden. In Geburtskliniken werden Frauen selten, Männer üblicherweise nicht auf Depressionsrisiken hin untersucht. Das Problem wird also – wenn überhaupt – erst erkannt, wenn es auftritt. Dann allerdings, so hat sich gezeigt, fühlt sich das Pflegepersonal oft schlecht vorbereitet im Umgang mit den Bedürfnissen der Väter. Eine rechtzeitige Intervention könnte dagegen die psychische Gesundheit der Väter fördern.
Interventionen des medizinischen Personals, die z.B. Väter im Umgang mit ihren neugeborenen Babys schulen, sind dabei hilfreich: Väter fühlen sich dadurch in ihrer Erziehungskompetenz anerkannt, das Gefühl der wahrgenommenen Elternwirksamkeit und die Kontrollwahrnehmung der Väter wird gestärkt. Insgesamt wirken derartige Maßnahmen damit angstreduzierend.
Gestärkte Väter fühlen sich in der Folge vermehrt auch als Teil des ‚Elternbündnisses‘. Selbstverständlich müssen solche Interventionen auf die jeweiligen Bedürfnisse der Väter abgestimmt sein. Dazu gehört zum Beispiel das Überwinden der Unsicherheit, wie sie mit ihren Babys interagieren, wie sie deren Bedürfnisse erkennen und ihnen entsprechen können.
In der Zeit nach der Geburt eines Kindes sind Väter bzw. ihre Partner für die Mütter generell die wichtigste Unterstützung. Andererseits können Väter gerade nach der Geburt des ersten Kindes betreffend ihre neue Rolle als Kinderbetreuer und Partner stark verunsichert sein. Die Paare stehen also, wenn es um Unterstützung geht, in einer Art gegenseitiger Abhängigkeit zu einander. So kann aus der Depression eines Elternteils eine Abwärtsspirale für beide Partner entstehen. Eine zweite Wechselwirkung besteht zwischen einer nicht zufriedenstellenden Paarbeziehung und dem Auftreten einer väterlichen postnatalen Depression.
In Anbetracht der gravierenden Auswirkungen, die eine Depression auf das Familienleben, die Partnerschaft und das Kindeswohl haben kann, schlagen die Autor:innen vor, Maßnahmen der Früherkennung von depressiven Störungen nach der Geburt eines Kindes in Zukunft vermehrt auch für Väter zu ergreifen. Dies gilt insbesondere für Paare, in denen die Mütter von postnataler Depression betroffen sind.